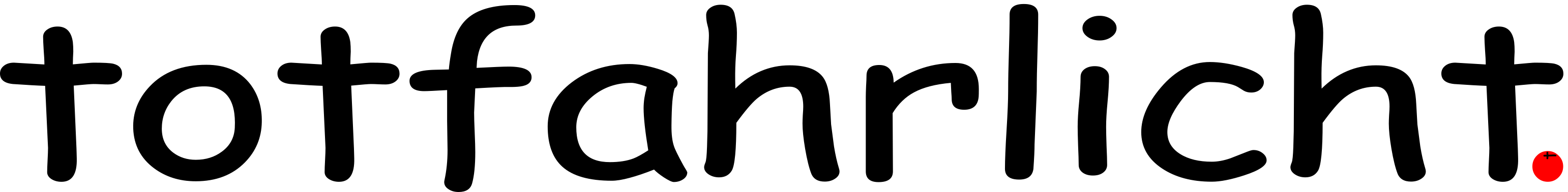Wir geneigten Mitteleuropäer neigen bekanntlich dazu, unsere eigenen Maßstäbe gern an die ganze Welt anzulegen. Doch anstatt die Maßstäbe je nach Situation passen zu machen, wollen wir nur zu gern die Welt an unser Maß anpassen. 
So kommt es, dass unser Bild von Afrika geprägt ist durch Film und Fernsehen: Tarzan, Daktari und andere Hollywood-Produktionen habenden Grundstein gelegt, diverse Verfilmungen romantischer Schmachtromane der öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren immer gleichen Schauspielern und Drehbüchern in Manier von Rosamunde Pichler setzen diesem Zerrbild noch die Krone auf.
Seit der Fußball-WM in Südafrika und der FIFA-genehmen Berichterstattung über das Land glaubt ohnehin eine große Mehrheit, in ganz Afrika sehe es genau so aus, wie es gerade vom Bildschirm geflimmert ist. Afrika, das ist doch eh’ alles gleich, das ist doch eigentlich ein riesiges Land, das nur von völlig willkürlichen und überflüssigen Grenzziehungen zerstückelt worden ist. Wie zum Beweis hat ja anscheinend ganz Afrika für das Team aus Ghana gejubelt.
Nach einem letzten, schönen Abend in Dakar muss ich also wieder in einen Flieger der Fluggesellschaft steigen, die schon beim Hinflug mein Gepäck zerstückelt hat. Mit äußerst ungutem Gefühl also gebe ich meine große Tasche auf, nachdem ich mir vorgestellt habe, was wohl geschehen mag, wenn ich versuche, diese im Gepäckfach zu verstauen. Das Fach verschließen ist bei der Größe nicht drin, und wenn diese 30 Kilogramm auf die Stewardess fallen … dann doch lieber das kleinere Risiko.
Um es vorweg zu nehmen: diesmal kommt die Tasche so an, wie man es eigentlich erwarten sollte. Doch das Vertrauen darin scheint hier wohl arg gelitten zu haben: Ich sehe fast mehr Gepäck als Passagiere an Bord. Knapp anderthalb Stunden Flugzeit, dazu noch die übliche Stunde Verspätung – das reicht soeben für ein Käsebrötchen und einen Kaffe über den Wolken.
Beim Kaffee wird es schwierig: Eigentlich war im Flugplan vorgesehen, zum Brötchen ein kaltes Getränk zu servieren, doch mit Tomatensaft kann ich entgegen der vorherrschenden Mode auch in einem Flugzeug nichts anfangen. Ein kleiner Flirt mit der Stewardess hilft aber zum Glück, und mein Lebenselixier steht kurz darauf frisch gebrüht und dampfend vor mir.
Da ich Kaffe in alter Manier aus Zeiten vor der political correctness gerne weiblich trinke – heiß, blond und süß, habe ich nun ein Problem. Die Manager von Fluggesellschaften drängt es offenbar dahin, alle Fluggäste zu standardisieren: In einem Plastikbeuten eingeschweißt finde ich – ebenfalls aus Plastik – Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel, Serviette, Milchpulver und Zuckerbeutel. Von jedem Teil ist genau ein einzelnes Stück in der Packung. Damit wird der Kaffe nicht einmal rehbraun und alles andere als süß.
Artig erklärt mir eine andere Stewardess, die sich eigentlich schon an die Abräumarbeit begeben wollte, dass mehr nicht vorgesehen sei. Also Flirtstufe zwei einschalten, und – siehe da: Ich bekomme zwei weitere Beutel. Allerdings nicht zwei Beutel Milch oder Zucker oder gar von jeden zwei Beutel, sondern zwei weitere Beutel mit dem kompletten Holzklasse-Verköstigungswerkzeug.
Was um alles in der Welt mache ich jetzt mit so vielen Gabeln, Löffeln und Servietten – von den Messern ganz zu schweigen, man könnte mich jetzt auch für einen Terroristen halten, der jeden Augenblick in die Kabine zum endlos in sein Mikrophon nuschelnden Kapitän rennt, ihm ein oder zwei dieser Waffen an den Hals hält und den Flieger nach Beirut umleiten will, nach Jemen oder sonst wo hin.
Leicht verstört entschließe ich mich, nichts dergleichen zu tun, obwohl zumindest die Aufforderung, die vielen Durchsagen wenigstens verständlich und nicht im üblichen und wahrscheinlich jahrelang einstudierten (warum eigentlich?) Singsang durchzugeben, einen derartigen Versuch rechtfertigen könnte. Daher verstecke ich die vielen überflüssigen Waffen geschickt in der ohnehin schon überfüllten Ablage vor mir.
In Freetown gelandet bereue ich, nicht wenigstens ein Messer behalten zu haben: Im Gegensatz zu Dakar ist das hier eine völlig andere Welt. Während weite Teile Senegals auch nicht viel anders aussehen als der tiefe Süden Italiens oder der hohe Norden Albaniens, scheint das Abenteuer hier so richtig in Schwung zu kommen. Den Aufforderungen des Begleiters, der mich freundlicherweise vom Flughafen abholt, um mich die 150 Meter bis zum wartenden Bus zur Fähre zu eskorti eren, folge sogar ich sehr gerne.
eren, folge sogar ich sehr gerne.
Nach gut einer Stunde sind alle Passagiere für die Fähre an Bord, es geht endlich los. 20 Minuten mit dem Bus zur Fähre, dann nochmals 40 Minuten Überfahrt über die Lagune, die den Flughafen von der Stadt Freetown trennt. Es gibt auch einen Helikopterservice, will heißen: Gleich mehrere Unternehmen bieten diesen Dienst an und unterbieten sich mit den Preisen, daher wäre dies nicht einmal teurer gewesen.
Inzwischen habe ich erfahren, warum unser Büro in Freetown die Fähre ausgesucht hat: Die Hubschrauber stammen noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg – sind also mindestens 20 Jahre alt. Das allein wäre ja noch zu verkraften, aber diese Dinger stammen aus schon damals alter russischer Produktion und haben im Krieg auch noch die ein oder andere kleinere Macke abbekommen. Da der Bus direkt an den Maschinen vorbei fährt, kann ich mich auch mit eigenen Augen überzeugen, dass diese höchstens zur Missionierung taugen: Spätestens beim Abflug wird garantiert jeder Passagier beten lernen.
Sollten Sie irgendwann einmal den Drang verspüren, nach Freetown zu fliegen, so kann ich das durchaus verstehen und absolut befürworten. Die Stadt und das ganze Land sind wunderschön und eine Reise hier hin lohnt wirklich, aber seien Sie gewarnt: Die mitteleuropäischen Maßstäbe müssen Sie schon Zuhause lassen. Und nehmen Sie auf jeden Fall die Fähre – nicht, dass ich Sie nicht gerne beten sehen würde, aber diese herrlich romantische Überfahrt unter klarem Sternenhimmel entschädigt für die Unannehmlichkeiten jeder Fluggesellschaft.